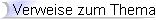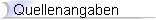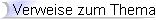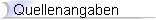Als die Eisenbahn ab den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ihren Siegeszug
antrat, und das neue Verkehrsmittel zur wirtschaftlichen Erschließung einzelner Regionen
beitrug, wurden die führenden Kreise der Unternehmer und des Großgrundbesitzes von einem
regelrechten Eisenbahntaumel erfaßt, zog doch der Bau von Eisenbahnen von weither
Arbeitskräfte an. Die Profite der ansässigen Unternehmen stiegen ebenfalls rasch.
Man erkannte sehr bald, daß die Eisenbahn günstige Bedingungen für die Bildung von
Ballungszentren schuf, aber anderseits für die abgelegenen Gebiete die Gefahr bestand, zu
veröden und für immer Hinterland zu bleiben. Verständlicherweise drängten deshalb die
in derartigen Gebieten ansässigen Vertreter der Wirtschaft auf Eisenbahnbau. Diese
Forderungen mußten aber bald an ihre ökonomischen Grenzen stoßen. Die
außerordentlichen Kapitalaufwendungen für den Bau und Betrieb von Eisenbahnen konnten
sich nur dort lohnen, wo ein ausreichendes Verkehrsaufkommen gesichert war.
Erfahrungen aus anderen Ländern, insbesondere Frankreich, zeigten, daß Eisenbahnen im
Bau und Betrieb billiger sein konnten, wenn man eine geringere Spurbreite wählte, die
schärfere Steigungen und Kurven, leichtere Schienen, weniger aufwendige
Streckenüberwachung zuließ und die Anforderungen an Brücken und Tunnel gering hielt.
Dafür mußte man zwar eine wesentlich niedrigere Fahrgeschwindigkeit in Kauf nehmen, die
jedoch auf den in Frage kommenden Strecken als ausreichend angesehen wurde. Während bei
den normalspurigen Bahnen seit den siebziger Jahren allein dem Staat das Recht zum Bau und
Betrieb zufiel, bestand bei den Schmalspurbahnen die Möglichkeit, daß private
Gesellschaftsunternehmen nach Erteilung einer staatlichen Konzession solche bauen und
betreiben konnten.

Aktie der GMWE aus dem Jahr 1901
In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden um Meuselwitz erhebliche
Braunkohlenfelder erschlossen, für die man nun einen erweiterten Absatzmarkt suchte, den
man auch in Gera fand. Gera war zu dieser Zeit eine aufstrebende Industriestadt, dessen
Unternehmen ihrerseits danach trachteten, schnell, sicher und relativ billig Kohle
heranzubekommen. Es begann sich alsbald Komitees für den Bahnbau zu bilden. Einen
wesentlichen Anteil daran hatte die Berliner Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Vering
und Wächter, die bei Wuitz
auch Braunkohlengruben besaß, und die Projektierung und Bau der Strecke übernehmen
wollte.

Der Bahnhof
Wuitz-Mumsdorf Im Holzgebäude links befand sich der Warteraum für die Reisenden.Rechts,
neben dem Hauptgebäude, befinden sich der Güterschuppen und der "Freiabtritt"
(Toilette).
Aus dem Kreis Zeitz war es Hauptsächlich der Rittergutsbesitzer Kurt Garcke aus
Wittgendorf, der sich für den Bau der Bahn einsetzte. Hier wie auch andernorts konnte man
die Erscheinung beobachten, daß private Unternehmer überall dort Kapital beim Bahnbau
anlegen wollten, wo der erwartete Profit garantiert war, und das schien bei dieser
Kleinbahn durchaus der Fall zu sein.
Die Erteilung der Konzession verzögerte sich jedoch immer wieder. Obwohl die
Länderregierungen beim Bau von Schmalspur- und Kleinbahnen mit lokaler Bedeutung die
private Initiative - im Interesse einer Entlastung des Staatssäckels - nicht ungern
sahen, befürchteten sie jedoch, daß den Staatsbahnen hier eine unliebsame Konkurrenz
erwachsen konnte. Von Meuselwitz bestand sowohl über Zeitz wie auch über Ronneburg eine
gute Verbindung nach Gera.
Am 6. Juli 1900 konstituierte sich in Meuselwitz eine Aktiengesellschaft mit dem Ziel,
eine "Kohlenbahn" von Meuselwitz nach Gera zu bauen. Im selben Jahr wurde auch
die Konzession erteilt und mit dem Bau begonnen. Die Baukosten veranschlagte man mit 1 770
000 Mark. Die Projektierungsarbeiten waren schon vorher durchgeführt worden. Die
Spurweite entsprach mit 1000 Millimeter der der Grubenbahnen und der Geraer Straßenbahn,
so daß ein direkter Wagenumlauf von der Grubenbahn über die Gera-Wuitz-Mumsdorfer
Eisenbahn nach Gera und dort über Straßenbahngleise in die Betriebe möglich wurde.

Die Lok 99 191 mit
einem Personenzug im Bahnhof Gera-Pforten im Mai 1967
Über den Verlauf der Strecke standen zwei Varianten zur Debatte, die erste sah den
Beginn in Gera-Pforten, die zweite in Langenberg vor. Für die erste hatte man sich dann
entschieden. Sie bestand dann bis auf einige Gleisbegradigungen bis an das Ende der
Strecke.
Nach fast zwanzigjährigen Vorbereitungen und einjähriger Bauzeit wurde dann am 12.
November 1901 die Gera-Meuselwitz-Wuitz-Mumsdorfer Eisenbahn, kurz GMWE genannt,
eröffnet. Vormittags 9 Uhr 30 Minuten setzte sich ein Zug vom Bahnhof Gera-Pforten zur
Eröffnungsfahrt in Bewegung. In sechs bekränzten und girlandengeschmückten Wagen hatten
die geladenen Gäste, unter ihnen der Erbprinz Heinrich XXVII., Reuss jüngere Linie,
Platz genommen. Auf allen größeren Bahnhöfen wurde der Zug mit entsprechender
Zeremoniell ein gebührender Empfang bereitet. Der Bahnbau fand bei den Einwohnern der an
der Strecke liegenden Gemeinden eine hohe Resonanz. Obwohl nur eine "Bimmelbahn"
wie sie der Volksmund nannte, hatte sie doch relativ abgelegenes Gebiet die
verkehrsmäßige Erschließung gebracht, von der sich alle Vorteile versprachen. Deshalb
ließ man auch hier die letzten Postillione zum Abschied blasen. Die von Zeitz aus noch
bestehenden Kariolposten nach Kayna und Pölzig wurden mit Wirkung vom 1. Dezember
eingestellt und ihre Aufgaben von der Schmalspurbahn übernommen.
Die gesamte 31,2 Kilometer lange Strecke verlief immerhin über das Gebiet dreier
deutscher Territorialstaaten, Reuß jüngere Linie, Sachsen-Altenburg und im Gebiet des
Kreises Zeitz durch Preußen. Nach 1952 waren es Die Bezirke Gera, Halle und Leipzig.
Wie schon erwähnt, bildete Gera-Pforten den Ausgangspunkt der Strecke. Von hier aus ging
es gleich steil bergan mit der höchsten Steigung der Strecke von 1 :28 nach Leumnitz. Die
nächsten Haltestellen richtete man in Trebnitz, Schwaara, Brahmenau, Culm, Söllmnitz und
Wernsdorf ein. Pölzig lag damals auf dem Gebiet von Sachsen-Altenburg, erste Haltestelle
im Kreis Zeitz war Wittgendorf. In vielen Windungen versuchten die Erbauer, die Strecke
auf der Wasserscheide zwischen beiden Schnauderbächen in möglichst gleicher Höhe zu
halten. Stellenweise von nur fünf Kilometer/Stunde ging es nach Kayna weiter an der
Rothenfurter Mühle vorbei, im stillen Grund an der Schnauder entlang zu den Quarzwerken
in der Kliebe. Hier befand sich ein Verladegleis für die hier gewonnenen Baustoffe. An
der Meutitzmühle vorbei führte die Strecke zum Haltepunkt Oelsen, von da aus weiter zur
Grube Leonhard II bei Spora ins Gebiet der Tagebaue und Brikettfabriken. An der
Schnauderbrücke gab es eine Wasserentnahmestelle für die Loks.
Die Haltestelle Zipsendorf
befand sich gleich neben der Zeitz-Altenburger Straße. Von dort an lief die
Schmalspurstrecke neben der normalspurigen Strecke Zeitz-Altenburg bis zum Bahnhof
Wuitz-Mumsdorf, dem Endpunkt der Strecke.

Ein Personenzug mit
Güterbeförderung in Richtung Wuitz-Mumsdorf im Februar 1958 zwischen Kayna und Oelsen
Der Bahnhof Wuitz-Mumsdorf
wurde auch von der normalspurigen Bahn mit benutzt. Aus diesem Grund war ein Teil der
Gleise innerhalb des Bahnhofes als Dreischienengleis ausgeführt. Die Wagenladungen der
Quarzwerke wurden auf einer Rampe aus Kipploren in offene Waggons gekippt. Auf der Strecke
trennten kaum Einzäunungen den Gleiskörper vom offenen Gelände. Ein erhöhter Bahndamm
fand sich nur vor Brücken und Berganfahrten. Anschlußgleise zweigten in die
verschiedensten Betriebe ab, das längste war mit 2,4 Kilometern die Verbindung zwischen
dem Bahnhof Söllmnitz und der Reußengrube bei Kretzschwitz.
Zum Zeitpunkt der Eröffnung bestand der Fahrzeugpark aus vier Lokomotiven, vier
Personenwagen, zwei Post- und Gepäckwagen, sechs gedeckten Güterwagen, 54 offenen
Güterwagen, zwei Kalkdeckelwagen und drei Rollböcken.
Die ersten Betriebsjahre zeigten eine positive Entwicklung, die Beförderungsleistungen
für Güter und Personen stiegen ständig an. Die Bahnstrecke beeinflußte die
Neugründung und Ausdehnung von Betrieben, 1905 richtete die Bahn einen Haltepunkt am
Quarzwerk Kayna ein, wo die Firma Buchmann aus Gera den Abbau von Kiesen und Quarzsanden
betrieb. Mit Hilfe einer Seilbahn wurden die Güterwagen beladen, deren Inhalt dann im
Bahnhof Wuitz-Mumsdorf über eine Rampe in Waggons der normalspurigen Eisenbahn gekippt
wurden. Bedingt durch steigenden Transportaufgaben erhöhte sich der Fahrzeugpark bis zum
Ersten Weltkrieg um zwei Lokomotiven, zwei Personenwagen und 52 offene Güterwagen. Der
Erste Weltkrieg bereitete dieser Aufwärtsentwicklung ein vorläufiges Ende, denn alle
nicht kriegswichtigen Bahnen mußten Betriebseinschränkungen vornehmen. Kürzungen der
Kohlezuteilung, Mangel an geschultem Personal und unzureichende Unterhaltungsarbeiten
kamen hinzu. Die ersten Nachkriegsjahre brachten, bedingt durch die wirtschaftliche
Situation in Deutschland, weitere Verschlechterungen mit sich. Die finanziellen
Schwierigkeiten wuchsen derart an, daß man eine Einstellung der Bahn ab 11. Oktober 1920
in Erwägung zog.
Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der Strecke bemühte sich die Stadt Gera um die
Aufrechterhaltung des Verkehrs mit der Gera-Meuselwitz-Wuitz-Mumsdorfer Eisenbahn (GMWE).
Es hat zu dieser Zeit auch wahrscheinlich ein Wechsel in der Zusammensetzung der
Gesellschafter stattgefunden. Der Sitz der Leitung bis dahin in Berlin, wurde 1921 nach
Gera verlegt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Bahnanlagen in einem äußerst
schlechten Zustand. Ein großer Teil der Gleise mußte erneuert werden, was in den
darauffolgenden Jahren geschah.
Die fortschreitende Geldentwertung ließ aber die Ausgaben in astronomische Höhen
klettern, ohne daß die Möglichkeit bestanden hätte, einen Ausgleich durch Tarife zu
schaffen, da die Tranportleistungen durch den allgemeinen Rückgang der Produktion in
Industrie und Landwirtschaft ständig sanken. In den zwanziger Jahren gewann der
Kraftverkehr immer mehr an Boden. Beachtliche Vorteile im Güter- und Personenverkehr bei
gleichen und mitunter niedrigen Tarifen brachen allgemein die Monopolstellung der Bahnen
im Landverkehr. Die Reichspost richtete von Zeitz aus eine Omnibuslinie nach Kayna und
Pölzig ein, die täglich bis zu viermal verkehrte.
Um die Leistungen im Personenverkehr zu verbessern, setzte die Gera-Wuitz-Mumsdorfer
Eisenbahn als erste deutsche Schmalspurbahn gegen Ende der zwanziger Jahre einen
Triebwagen ein. Genauer betrachtet war es ein auf Schienen gesetzter Straßenomnibus, der
von der Linke-Hofmann-Busch-AG in Werdau (Sa.) gebaut wurde.
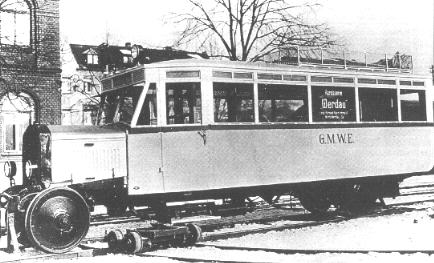
Der Triebwagen VT 133
521 mit der Wendeeinrichtung im Bahnhof Gera-Pforten
Als reines Ein-Richtungsfahrzeug mußte es zu jedem Fahrtrichtungswechsel gedreht
werden. Die Fahtgäste konnten nur auf der rechten Seite ein- und aussteigen. Für
größere Gepäckstücke diente ein Dachgepäckträger. Das Fahrzeug wurde im Volksmund
"Schienen-Zepp" genannt und soll sich recht gut bewährt haben. Bedingt durch
seine leichte Bauweise ist der Bus mehrmals entgleist. Nach der 1949 erfolgten Übernahme
der GMWE durch die Deutsche Reichsbahn setzte man ihn nach Barth um. Er kam auf der
Strecke nach Ribnitz-Damgarten zum Einsatz. Nach langer Abstellzeit wurde er 1961
schließlich ausgemustert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg übergab die Sowjetische Militäradministration mit Wirkung vom
1. September 1945 die Eisenbahn in die Hände des Volkes. In der sowjetischen
Besatzungszone gab es zu diesem Zeitpunkt rund 3300 Kilometer nichtreichsbahneigener
Bahnlinien, davon waren 1600 Kilometer schmalspurig. Auch diese Bahnen sollten nicht mehr
lokalen Sonder- und Privatinteressen dienen, sondern der gesamtgesellschaftlichen
Entwicklung in der sowjetischen Besatzungszone untergeordnet werden. Somit wurden alle dem
öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen auf Beschluß der Deutschen
Wirtschaftskommision vom 9. März 1949 der Deutschen Reichsbahn unterstellt. Darunter fiel
natürlich, wie schon angedeutet, auch die Gera-Meuselwitz-Wuitz-Mumsdorfer Eisenbahn
(GMWE).

Der Bahnhof Kayna, er besaß große Bedeutung für die
Agrarwirtschaft, insbesondere landwirtschaftliche Massengüter, wie Futterrüben und
Kartoffeln, traten von hier aus ihre Reise zu den Verbrauchern an.
Ab 1955 gehörte die Strecke der Reichsbahndirektion Dresden, von der Schmalspurbahn
Eisfeld - Schönbrunn wurde 1955 eine Lokomotive umgesetzt. Es war nach 33 Jahren wieder
das erste Mal, daß der Triebfahrzeugpark erweitert wurde. Von der Spreewaldbahn kam 1962
eine weitere und von der Harzquerbahn noch eine dritte Lokomotive zur GMWE. Letztere kam
jedoch auf der Strecke nie zum Einsatz und wurde 1963 verschrottet. Mitte der 60er Jahre
verlor diese Bahn immer mehr an Bedeutung, die Kohlengruben um Wuitz-Mumsdorf waren
erschöpft, so daß sich die Geraer Abnehmer nach neuen Bezugsquellen über andere
Verkehrsverbindungen umsehen mußten. So wurde 1966 der Güterverkehr eingestellt, nur der
Transport des Quarzsandes von der Kliebe zum Bahnhof Wuitz-Mumsdorf wurde weitergeführt.
Die weiter sinkende Rentabilität ließ das Ende der Gera-Wuitz-Mumsdorfer Schmalspurbahn
langsam in Sichtweite rücken.
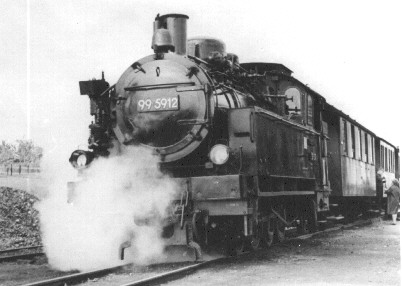
Die Dampflok 99 5912, zusammen mit der Lok 99 5911 im Jahre 1922
angeschafft und in Betrieb genommen. Die Lok 99 5912 hatte bis 1967 eine Laufleistung von
832657 km erreicht. Beide Lokomotiven waren bis zur Betriebseinstellung im Einsatz.
Ein übriges dazu tat noch der internationale Trend mit einer expansiven Entwicklung
des Kraftverkehrs und einem immer mehr um sich greifenden Sreckenabbau der Bahnen. Es ist
verständlich, daß hierbei die Schmalspurbahnen aus ökonomischen Gründen an erster
Stelle standen. Notwendige Modernisierungen waren gegenüber den wirtschaftlichen
Ergebnissen keineswegs gerechtfertigt. Ein Beschluß des Ministerrates der DDR vom 14. Mai
1964 sah die schrittweise Stillegung von fast 70 % der Schmalspurbahnen bis 1970 vor.
Darunter fiel auch die Gera-Meuselwitz-Wuitz-Mumsdorfer Schmalspurbahn. Das etwa fünf
Kilometer lange Stück von der Kliebe bis zum Bahnhof Wuitz-Mumsdorf sollte von den
Kaynaer Quarzwerken weiter als Werkbahn betrieben werden. Entsprechende Vorbereitungen
wurden getroffen, so setzte man eine Diesellok vom Betonwerk Cretzwitz um;
Versuchsbohrungen ergaben jedoch nur noch eine geringe Fündigkeit an Quarzsanden, so daß
sich ein weiterer Abbau nicht mehr lohnte. Betriebseinstellung und Streckenstillegung
sollten möglichst zusammenfallen.
Am 3. Mai 1969 ging im Raum Gera ein schweres Unwetter nieder und zerstörte einen
erheblichen Teil der Gleisanlagen zwischen Gera-Pforten und Leumnitz. Das gesamte Gelände
des Bahnhofs Gera-Pforten war überschwemmt. Die entstandenen Schäden zu beseitigen,
wäre volkswirtschaftlich nicht vertretbar gewesen, da ja die Einstellung des Verkehrs
ohnehin für 1970 vorgesehen war. Mit dem 4. Mai 1969 stellte die Schmalspurbahn
Gera-Wuitz-Mumsdorf nach 68 Jahren den Betrieb ein. Lediglich auf dem Abschnitt von der
Kliebe nach Wuitz-Mumsdorf erfolgte noch bis 1. Januar 1970 der Transport von Quarzsanden.
(Quelle: Aus der Tageszeitung "Der Neue Weg" - Jahr leider nicht bekannt)
|
Zeittafel
1900
In Meuselwitz konstituiert sich eine Aktiengesellschaft mit dem Ziel, eine "Kohlenbahn" von Meuselwitz nach Gera zu bauen
1901
Streckeneröffnung
Der erste Zug fährt am 12.11.01 von Gera-Pforten nach Wuitz-Mumsdorf.
1905
Am Quarzwerk Kayna wird ein Haltepunkt eingerichtet.
1920
Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten wird die Einstellung der Bahn in Erwägung gezogen.
1949
Die Bahn wird der Deutschen Reichsbahn unterstellt.
1955
Der Triebfahrzeugpark wird nach 33 Jahren um eine Lokomotive erweitert.
1966
Einstellung des Güterverkehrs, nur der Transport von Quarzsanden von der Kliebe nach Wuitz-Mumsdorf wurde weitergeführt.
1964
Der Ministerrat beschließt die Stillegung der Schmalspurbahn bis 1970.
1969
Am 3.Mai zerstört ein Unwetter im Raum Gera erheblichen Teil der Gleisanlagen.
Am 4.Mai stellt die Schmalspurbahn ihren Betrieb ein.
1970
Am 1.Januar wird auch der Transport von Quarzsanden von der Kliebe nach Wuitz-Mumsdorf eingestellt.
Haltestellen
Gera-Pforten
Gera-Leumnitz
Trebnitz
Schwaara
Brahmenau Süd
Brahmenau
Söllmnitz
Wernsdorf
Pölzig
Wittgendorf
Kayna
Kaynaer Quarzwerk
Oelsen
Spora
Zipsendorf
Wuitz-Mumsdorf
|